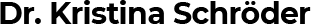Eine Stunde, die ich am Schreibtisch oder in einer Talkshow verbringe, kann ich nicht bei meinen Töchtern sein. Und beim Frühstück mit der Familie am Samstag verpasse ich vielleicht den Parteitag. Dieses Dilemma wird kein staatliches Betreuungsangebot auflösen können. Auch wir Eltern in der Politik müssen uns daher für unsere Prioritäten bei der Vereinbarung von Familie und Beruf entscheiden. Und daher sollten gerade wir uns auch nicht anmaßen, die Entscheidungen anderer Familien zu beurteilen und nur das Modell für “modern” halten, das wir selbst gerade leben.
In Deutschland tobt nach wie vor ein Kulturkampf um das richtige Frauenleben. Widmet man sich ganz der Karriere, gilt man als „egoistische Karrierefrau“. Tritt man beruflich kürzer, um mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, ist man das „Heimchen am Herd“. Und versucht man Kind und Karriere miteinander zu vereinbaren, lautet das Verdikt wahlweise „Rabenmutter“ oder „Latte-Macchiato-Mutter“. Auch die Politik fällt bis weit in meine eigene Partei hinein fröhlich Werturteile über angeblich „veraltete Rollenbilder“ und „moderne partnerschaftliche Familien“. Als Vater, der sich entscheidet, einige Jahre beruflich kürzer zu treten, wird man als „moderner Mann“ gefeiert. Trifft man allerdings als Frau dieselbe Entscheidung, konnte man leider „traditionelle Rollenklischees nicht aufbrechen“ und ist „in die Teilzeitfalle“ getappt.
Bei so viel Anmaßung der Politik, diese zutiefst private Entscheidung, wie zwei erwachsene Menschen ihr Familienleben organisieren, zu benoten und zu reglementieren, sollten wir Politikerinnen und Politiker uns nicht wundern, wenn es uns ebenso ergeht. Auch über uns wird als Mütter und Väter fröhlich geurteilt. „Wie soll das bitteschön gehen – Mutter sein und gleichzeitig Ministerin und Abgeordnete? Kann sie das schaffen?“ argwöhnte das Zeit Magazin, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war. Die Kollegen von Zeit-Online hingegen mahnten: „Es wäre ein schlechtes Signal, wenn Kristina Schröder jetzt in ein traditionelles Rollenbild zurückfällt und für längere Zeit nach der Geburt ihres Kindes im Job aussetzt.“
Letzterer Ratschlag war vor allem deswegen putzig, weil Abgeordnete ohnehin die einzige Berufsgruppe in Deutschland sind, für die es kein Recht auf Elternzeit gibt. Sie haben also gar nicht die Möglichkeit, nach der Geburt auszusetzen, selbst für den Mutterschutz gibt es bei strenger Betrachtung keine Rechtsgrundlage. Dass Bundestagsabgeordnete Mütter werden, ist schlicht nicht vorgesehen.
Und lange Zeit fand es auch nicht statt. Elfriede Klemmert-Hamelbeck (CDU) war 1960 die erste Bundestagsabgeordnete, die während ihres Mandats ein Kind bekam, ein Jahr später ihr zweites. In den folgenden zwei Legislaturperioden hat nach meinen Recherchen keine Bundestagsabgeordnete ein Kind geboren – was auch nicht verwunderlich war, schließlich gab es etwa 1970 keine einzige Bundestagsabgeordnete unter 40. 1972 und 1974 brachte dann Hertha Däubler-Gmelin (SPD) zwei Kinder zur Welt. Aber auch in den folgenden Legislaturperioden war dies ein seltenes Ereignis.
Und heute? Inzwischen ist der Bundestag deutlich jünger und weiblicher geworden. Hinzu kommt, dass weibliche Abgeordnete meiner Generation meistens nicht mehr bereit sind, wegen der Karriere auf Kinder zu verzichten. Die Folge: In der aktuellen Legislaturperiode waren wir bereits 21 Abgeordnete, 20 Kolleginnen und ich, die neben dem Mandat ein Kind zur Welt brachten. Der Anblick von Kinderwagen vor dem Plenarsaal ist kein seltener mehr.
Aber natürlich wird gerade uns Politikerinnen oft die Frage gestellt, ob sich Familie und Spitzenpolitik überhaupt vereinbaren lassen. Meines Erachtens ist das die falsche Frage. Natürlich geht es. Zumal wir Abgeordneten ja auch genug verdienen, um uns Hilfe im Haushalt und bei der Betreuung zu engagieren.
Die Frage ist vielmehr, ob man es zu den Bedingungen will, unter denen es möglich ist. Denn ein Wiedereinstieg nach acht Wochen Mutterschutz bedeutet, ab dann auch mit einem Neugeborenen sein Leben mit zwei Wohnsitzen, Berlin und der Wahlkreis, organisieren zu müssen. Viele Kolleginnen nehmen ihr Baby im ersten Jahr immer mit, Kinderfrau oder Opa stehen dann mit dem hungrigen Säugling vorm Sitzungssaal und warten auf den nächsten Stillslot. Als Ministerin habe ich mich nach Nächten, in denen ich alle zwei Stunden gestillt habe, natürlich Bundespressekonferenzen mit 60 kritischen Journalisten stellen müssen, Bemerkungen über meinen „blassen Teint“ eingeschlossen. Wenn dann aber noch die Anfrage zur Live-Talkshow kam, die um 22 Uhr beginnt, war für mich der Punkt erreicht, an dem ich gestreikt habe. Ebenso bei vielen abendlichen Veranstaltungen und fröhlichen Runden in ganz Deutschland, bei denen Kontakte unter Parteifreunden gepflegt wurden.
Diese mangelnde mediale und tatsächliche Präsenz hat mir natürlich geschadet. Noch weniger Präsenz bei meiner Tochter hätte mich allerdings totunglücklich gemacht, und so war für mich die Entscheidung glasklar, lieber auf ein paar Fernsehauftritte zu verzichten. Denn zu einer ehrlichen Bestandaufnahme gehört die Einsicht in eine banale Tatsache: Wenn ich am Schreibtisch oder in der Talkshow sitze, kann ich nicht bei meinen Kindern sein. Und beim Frühstück mit der Familie am Samstag verpasse ich vielleicht gerade den Parteitag. Wie alle berufstätigen Eltern müssen wir Eltern in der Politik uns also entscheiden, was wir verpassen wollen. Und niemand sollte so tun, als könnten noch so gute und flexible Kitas dieses Problem grundsätzlich lösen.
Allenfalls mildern können wir dieses Dilemma. Für die Menschen, die in der Politik tätig sind, versuche ich mit Kolleginnen der anderen Bundestagsfraktionen Verbesserungen zu erzielen. Im Rahmen der Initiative „Eltern in der Politik“ setzen wir uns etwa für ein Spielzimmer im Deutschen Bundestag ein, in dem bei abendlichen Sitzungen auch Kinderbetreuung buchbar ist. Verpasst eine Abgeordnete auf Grund des Mutterschutzes namentliche Abstimmungen, haben wir erreicht, dass dieser Grund im Protokoll vermerkt wird. Vor allem aber haben wir eine Selbstverpflichtung für einen politikfreien Sonntag initiiert. Wenn in einer Sitzung nicht mehr der schief angeguckt wird, der sagt, er wolle sonntags bei seiner Familie sein, sondern der, der die Klausurtagung an diesem Tag stattfinden lassen will, ist schon einiges gewonnen.
Und dennoch geht es letztlich immer um die gleiche Frage: Ob Mutter oder Vater, ob Spitzenpolitik oder Vorstandsposten: Wer Karriere macht, hat in der Regel genug Geld, aber zu wenig Zeit. Und darunter leiden die Kinder, denn die haben, zumindest wenn sie noch klein sind, ein anrührendes Bedürfnis: möglichst viel mit ihrer Mama und mit ihrem Papa zusammen zu sein. Wir Eltern in der Politik ringen wie andere auch um den richtigen Weg. Würde dieser jeweils individuelle Weg auch allgemein respektiert werden, wäre schon viel erreicht. Dazu können wir aber auch beitragen: Indem wir wiederum Respekt vor allen Familienmodellen haben – und uns nicht anmaßen, nur die Rollenkonstellationen für „modern“ zu halten, die wir selbst leben.
Dieser Beitrag erschien zuerst im März 2017 im Tagesspiegel.